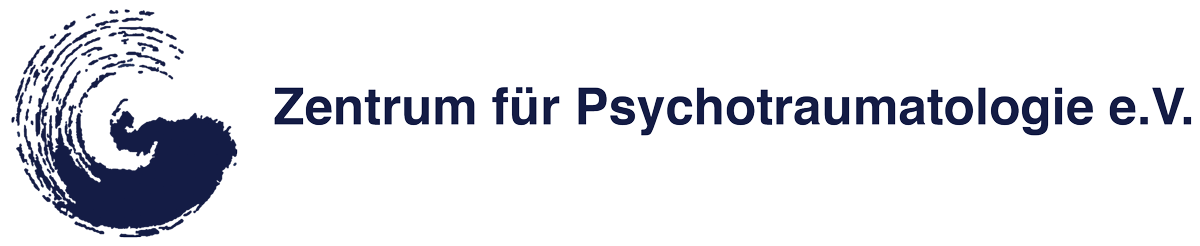
Inner Safety
5 Jahre „Inner Safety“ – Einführung in die Psychotraumatologie
Ein persönlicher Erfahrungsbericht von Sabine Schrader
Wie alles begann
2015 – Zahlen beherrschten die Schlagzeilen – jeden Tag neue. Wie viele Geflüchtete waren eingereist? Kaum schafften es andere Themen in die Schlagzeilen. Es gab ein deutliches „dafür“ oder „dagegen“, viele konstatierten eine Spaltung der Gesellschaft. Schnell musste auf eine bisher noch unbekannte Situation reagiert werden. Es gab viele Menschen, die so viel Kraft und Energie in die Arbeit geben (mussten), dass sie selbst keine Kraft mehr hatten und an ihre Grenzen kamen und es gab viele Menschen, die kaum in die Arbeit involviert waren und immer wussten, was man hätte besser machen können und viele stöhnten „Ich kann das Thema nicht mehr hören….“.
In dieser Situation erreichte uns (die Mitarbeiter*innen des Zentrums für Psychotraumatologie e.V. Kassel) die Anfrage, ob es nicht möglich sei, „speziell etwas für Geflüchtete“ anzubieten. Seit Gründung des Zentrums können Menschen unabhängig von Geschlecht und Herkunft die Angebote wahrnehmen, und immer wurden diese Angebote ausschließlich aus eigenen Einnahmen (aus der Fachfortbildung) und wenigen Spenden- bzw. Stiftungsgeldern finanziert – es gab nie eine regelhafte Finanzierung über öffentliche Haushalte, was dazu führte, dass die Beratungen kostenpflichtig waren und sind. Niemand musste aus finanziellen Gründen auf Beratungen verzichten, denn für diejenigen, die ein sehr niedriges Einkommen hatten wurden die Beiträge aus Spenden ersetzt. Hätten wir nun ein aus öffentlichen Geldern finanziertes Beratungsangebot ausschließlich für Geflüchtete geplant, so hätte dies dazu geführt, dass die Beratungen für geflüchtete Menschen kostenfrei gewesen wären, während alle anderen bezahlen müssten. Wir wollten keine Spaltung erzeugen im eigenen Angebot.
Die bundesweit erste zertifizierte „Fachfortbildung zur / zum Fachberater*in für Psychotraumatologie“ wurde von den Mitarbeiterinnen und Gründerinnen des Zentrums konzipiert und durchgeführt – damals wie heute war und ist „Psychotraumatologie“ nicht / kaum Inhalt der Ausbildungen und Studiengänge für die sozialen, helfenden und therapeutischen Berufe. Kenntnisse darüber sind kaum vorhanden, wenn sich die Angehörigen dieser Berufsgruppen nicht selbst entsprechend fortbildeten; ein großes Versäumnis in Anbetracht der Tatsache, dass Traumafolgesymptome aller Art (besonders unter Einbeziehung der transgenerationalen Weitergabe, sowie der Bindungsstörungen) Inhalt der täglichen Arbeit in diesen Berufen sind.
Auch ich hatte an dieser Fachfortbildung teilgenommen – es war eine von vielen in einem langen Sozialarbeiterinnenleben und diejenige, von der ich am meisten profitierte, persönlich und in der Arbeit. Es war so hilfreich gewesen, endlich Zusammenhänge besser zu verstehen und „Handwerkszeug“ zu bekommen, aber auch Möglichkeiten und Grenzen Betroffener und eigene Möglichkeiten und Grenzen deutlicher wahrzunehmen.
2015 mussten Unterkünfte, Jugendwohngruppen, Beratungsstellen, Ehrenamtsarbeit schnellstens etabliert und koordiniert werden. Viele Menschen arbeiteten am eigenen Limit. Natürlich gab es viele Ressourcen, viele Fähigkeiten, viel Mitmenschlichkeit und Zuwendung, aber auch viel Stress. Der Hochstress der Mitarbeitenden traf den Hochstress der Geflüchteten. Hinter vielen „normalen“ Stressreaktionen wurde sofort eine „Traumatisierung“ vermutet und tatsächliche Traumafolgesymptome blieben eventuell unerkannt. Es kam manchmal auch zu eher kontraindizierten Interventionen. In dieser Situation war es wichtig, Betroffenen und Mitarbeitenden zumindest Grundkenntnisse zum Thema zu vermitteln, um zu mehr Klarheit zu kommen. So entstand das Konzept für das Projekt „Inner Safety“ das dann am 01.04.2016 startete. Das Gefühl „innerer Sicherheit“ auch in Hochstresszeiten (wieder) zu erlangen oder zu halten – dazu braucht es zunächst einmal die Möglichkeit, eigene Symptome und die der anderen besser zu verstehen und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Psychoedukation ist wichtig, denn das Verstehen erleichtert den Umgang. Selbstverständlich kann ein Tag nicht eine einjährige Fortbildung ersetzen, aber Grundkenntnisse, Symptome und Zusammenhänge können erklärt werden.
„Einführung in die Psychotraumatologie“ – bundesweit als kostenfreie Inhouse-Schulung möglich.
Finanziert aus dem „Akutprogramm“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit dem Paritätischen Gesamtverband in Berlin, bietet das Projekt mit einer 32-Stunden Stelle die Möglichkeit, Trägern sozialer Arbeit und BiIdungsträgern bundesweit eine kostenfreie eintägige Schulung für die Mitarbeitenden zum Thema „Einführung in die Psychotraumatologie – mit besonderem Blick auf ‚Flucht und Trauma‘“ anzubieten. Es geht um die Vermittlung von Grundkenntnissen zum Thema für Menschen, die sich bisher kaum damit beschäftigt haben oder die sich eine „Auffrischung“ ihrer Grundkenntnisse wünschen. Um Stabilisierungstechniken und Interventions- sowie Beratungsmöglichkeiten kennen- und anwenden zu lernen, wäre die Fachfortbildung der richtige Rahmen. Weiterhin werden Fachberatungen angeboten (die sich meist aus den Veranstaltungen ergeben), sowie Beratungen in akuten Situationen oder Gruppenangebote für Betroffene, Sprachmittler*innen etc.
Traumatisierungen betreffen Menschen zunächst einmal gleichermaßen, so dass die Themen „Definition, Neurologie, PTBS, stabilisierende und destabilisierende Faktoren….“ unabhängig von der Herkunft gleich sind. Für Geflüchtete gibt es zusätzlich wichtige Themenbereiche, es bestehen hinsichtlich der Hilfsangebote Besonderheiten, und die Gruppe der sogenannten „unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen“ bedarf z.B. einer besonderen Betrachtung.
Mitarbeitende im Spannungsfeld von Bedarfen, Möglichkeiten, Grenzen und Resilienz
In den ersten zwei bis drei Jahren wurde ich überwiegend von Trägern sogenannter „UmA-Gruppen“, Beratungsstellen, Ehrenamtsverbänden, Gemeinschaftsunterkünften, Erstaufnahmeeinrichtungen angefordert.
Inzwischen sind es zusätzlich vermehrt Einrichtungen, in denen Geflüchtete nun „ankommen“, Jobcenter, Bildungsträger, Jugendämter, Landkreis- und Stadtverwaltungen, Pflegekinderdienste, Kitas, Jugendhilfeträger, Psychosoziale Dienste, etc. die sich freuen, dass es das Angebot einer kostenfreien Schulung gibt, denn der Bedarf an Fortbildung zu diesem Thema ist groß, die finanziellen Mittel dafür sind es eher nicht.
In den ersten Jahren wurde in den Veranstaltungen sehr deutlich, wie belastend die Arbeit für die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden in der Arbeit mit Geflüchteten ist. In den Gesichtern der Teilnehmenden war die Erschöpfung zu sehen und es war bei einigen Menschen deutlich zu Retraumatisierungen, Sekundärtraumatisierungen und Burn-out Verläufen gekommen. Spätere Erhebungen und Untersuchungen zu diesen Themen bestätigten dies. Der Krankenstand in den Einrichtungen war vergleichsweise hoch, die, die noch arbeiteten, mussten jeweils für die nicht Anwesenden mitarbeiten, und nach einiger Zeit zogen sich einige sowohl ehren- als auch hauptamtliche Mitarbeitende erschöpft aus der Arbeit zurück. Wie wichtig die Selbstfürsorge, der Selbstschutz gerade in solch fordernden Arbeitsbereichen ist, wurde unterschätzt – etwas was in den helfenden und sozialen Berufen häufig passiert.
Auch heute ist den Teilnehmenden an den Veranstaltungen noch die Anstrengung anzumerken und vor allem auch das Gefühl „gegen Windmühlen“ zu arbeiten. Zuviel Bedarf – zu wenig Hilfsangebote – auch das ein permanentes Thema in diesen Berufen. Viele Ressourcen, viel Kompetenz und Engagement ist in diesen Arbeitsbereichen zu finden und auch die Schwierigkeit Resilienz zu erhalten und zu stärken.
Traumatherapie ist Mangelware
Unter neun Monaten Wartezeit gibt es kaum eine Möglichkeit einen Therapieplatz bei ausgebildeten Traumatherapeut*innen zu bekommen, meist dauert es deutlich länger. Wartezeiten für stationäre Behandlungen in fachspezifischen Akut- oder Rehakliniken sind ebenfalls sehr lang – und dies gilt für Menschen, die Deutsch als Muttersprache haben oder zumindest sehr gut Deutsch sprechen. Für Menschen, die über diese Sprachkenntnisse nicht verfügen und/oder deren Aufenthaltsstatus noch nicht gesichert ist, gibt es kaum Therapieplätze. Viele Menschen, die ehren- oder hauptamtlich mit Geflüchteten arbeiten, bemerken die Stresssymptome und die Auswirkungen auf das alltägliche Leben und viele wünschen sich eine sofortige „Traumatherapie zur Verarbeitung“ für Betroffene, doch „Verarbeitung“ wäre für viele Menschen noch nicht möglich – erst einmal geht es häufig um Stabilisierung – auch um Stabilisierung der Lebensumstände, der sozialen Kontakte etc….Hier schließt sich der Kreis, denn um die Stabilisierung der Lebensumstände zu verbessern und um interkulturell stressreduzierende Stabilisierungstechniken zu vermitteln, wären mehr Ausbildung, bessere Arbeitsbedingungen und individuellere Interventionsmöglichkeiten von Nöten – generell und erst recht in der Arbeit mit Geflüchteten.
Aktuelle Situation
Die Zeit der täglich in den Medien erscheinenden Zahlen und Berichte zum Thema „Flucht“ ist vorbei – aktuell beherrschen andere Zahlen die Schlagzeilen. Viele Strukturen sind erschaffen worden, Verwaltungswege scheinbar geklärt. Bei einigen Geflüchteten, die inzwischen äußerlich stabilere Lebensumstände haben, können sich nun Symptome zeigen, die in der Zeit des Dauerstressprogrammes nicht „auftauchen“ konnten; viele andere Menschen sind inzwischen angekommen. Menschen, die jetzt noch in Deutschland aufgenommen werden, haben häufig sehr lange Fluchtwege hinter sich, nicht selten mit langen Aufenthalten in überfüllten Flüchtlingslagern wie Moria. Selbst wenn es einmal viele Ressourcen und Resilienz in Menschen gab – nach langen Aufenthalten an solchen Orten sind sie verbraucht. Dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche, die in diesen katastrophalen Lebensumständen „reifen“ sollen. Wenn sie es schaffen, hier anzukommen, zeigen sie häufig nicht „nur“ deutliche Symptome teilweise auch komplexer Posttraumatischer Belastungsstörungen, sondern leiden zusätzlich schon unter weiteren seelischen und körperlichen Erkrankungen. Es ist häufger mit längeren Verläufen und Bedarf nach Stabilisierungstechniken und Therapiemöglichkeiten (insbesondere für Kinder und Jugendliche) zu rechnen.
Ausblick und Dank
Die Folgen solcher und ähnlicher Erkrankungen werden immer Inhalt und Aufgabe der sozialen, helfenden und therapeutischen Berufe sein. Um diesen Anforderungen gewachsen zu sein, brauchen Mitarbeitende stabile gute Arbeitsbedingungen, denn nur wenn sie selbst über Stabilität und Resilienz verfügen, können sie zur Stabilität und Resilienz anderer Menschen beitragen. Und Wissen zum Thema ist die Grundvoraussetzung für ein sicheres Gefühl in der Arbeit. Auch in anderen Zusammenhängen, wie beispielsweise in der Arbeit mit Opfern sexualisierter Gewalt und/oder häuslicher Gewalt, Mobbingopfern etc. wird immer wieder deutlich, wie wichtig es wäre, Trauma und Traumfolgesymptome, Stabilisierungstechniken etc. obligatorisch in die Ausbildungs- und Studiengänge aufzunehmen, insbesondere auch für Mitarbeitende in Kita’s und Schulen. Solange dies noch nicht der Fall ist bietet die „InnerSafety“-Schulung einen ersten Einblick in das Thema – weiteres WIssen und „Handwerkszeug“ kann dann die Fachfortbildung vermitteln. Wissen zum Thema „Trauma und Traumafolgesymptome“, sowie zu den Stabilisierungsmöglichkeiten sollte zur Grundausbildung gehören, damit mehr innere Sicherheit bei Mitarbeitenden und somit auch bei Betroffenen erreicht werden kann.
Insofern hoffen wir auf Weiterführung und Ausbau des Programmes und darauf, unseren Teil zur Vermittlung von mehr „Inner Safety“ beizutragen.
Heute danke ich zunächst einmal von ganzem Herzen meinen Kolleg*innen vom Zentrum für Psychotraumatologie e.V. in Kassel, dass sie dieses Projekt ermöglichen und unterstützen und durch stürmische Zeiten begleiten und selbstverständlich auch den Mitarbeiterinnen des Paritätischen Gesamtverbandes in Berlin, ohne die wir nicht die Mittel aus dem Akutprogramm des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bekommen würden. Ich hoffe auf mehr „Inner Safety“ mit euch/Ihnen.
Kassel, im Juni 2021
Sabine Schrader